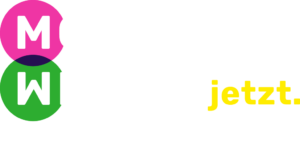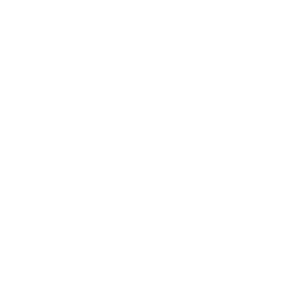Chemisches Recycling: Wie Kunststoffabfall zum Rohstoff für die Raffinerie wird.
Verschmutzte Folien, mehrlagige Verpackungen, gemischte Kunststoffe – bislang galten sie weitgehend als nicht recycelbar und landeten in der Müllverbrennung. Doch chemisches Recycling ändert die Spielregeln. Es verwandelt Problem-Plastik in wertvolle Grund- und Rohstoffe für Chemie und Industrie, nebenher entstehen Ausgangsstoffe für Benzin und Diesel. Das hilft bei der Transformation von fossilen zu CO2-armen Produkten und kann eine Lücke in der Kreislaufwirtschaft schließen. OMV zeigt in Österreich, wie das im industriellen Maßstab funktioniert.
Das Wichtigste in Kürze
- Aktuell wird noch ein Großteil des Plastikmülls verbrannt.
- Durch chemisches Recycling lässt sich bei Kunststoffen eine Kreislaufwirtschaft schaffen.
- OMV geht in Österreich mit dem ReOil-Verfahren voran.
- Derzeit gibt es in Deutschland noch keine tragfähigen Großprojekte, da die Rahmenbedingungen für Investoren unzureichend sind.
Mechanisches Recycling ist gut, aber reicht nicht aus
237 Kilo – so viel Plastikmüll produziert der oder die Durchschnittsdeutsche pro Jahr. Das entspricht laut Umweltbundesamt 5,9 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle (Stand 2023). In der gesamten EU summiert sich die Menge auf mehr als 30 Millionen Tonnen. Da bietet es sich an, diese Ressource im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wiederzuverwenden. Einerseits aus ökologischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen – denn das Potenzial ist groß.
Aktuell wird ein Teil der Kunststoffe zwar mechanisch zu Granulat recycelt, um daraus neue Flaschen, Verpackungen, Fasern, Dämmmaterial oder Möbel herzustellen. Doch bei stark verschmutzten, gemischten oder mehrlagigen Kunststoffen stößt dieses Verfahren an seine Grenzen. Deshalb kann ein großer Teil des Plastikmülls nicht wiederverwertet werden.

Mehr als die Hälfte der Kunststoffabfälle werden verbrannt
Ein Großteil dieser Plastikabfälle wird daher thermisch verwertet. Das heißt, er wird verbrannt oder landet auf Deponien. Die meisten Müllverbrennungsanlagen erzeugen zwar Strom oder Fernwärme, dennoch grenzt dieses Vorgehen an eine Verschwendung. Es gehen wertvolle Rohstoffe verloren und die Möglichkeit, Kohlenstoffe wiederzuverwerten und im Kreislauf zu halten, bleibt ungenutzt. Gleichzeitig belasten Müllverbrennung und Deponieentsorgung die Umwelt. Das Kunststoff-Recycling weiterzuentwickeln ist also dringend geboten. Dafür bietet sich als Ergänzung des mechanischen Recyclings das chemische Recycling an.
Gamechanger chemisches Recycling
Chemisches Recycling gleicht einem Paradigmenwechsel. Es ermöglicht, auch stark verunreinigte oder gemischte Kunststoffabfälle zu verarbeiten und daraus hochwertige Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Dabei kommen verschiedene Verfahren wie Pyrolyse, Solvolyse und Gasifizierung zum Einsatz. Diese verändern die chemische Struktur von Kunststoffabfällen, um sie in ihre Grundbausteine zerlegen zu können. (Umfassende Informationen zu den Verfahren des chemischen Recyclings von Kunststoffen finden Sie im Beitrag Chemisches Recycling von Kunststoffen – Chancen und Herausforderungen.)
Im Gegensatz zum mechanischen Recycling werden die Polymerketten beim chemischen Recycling aufgespalten, wodurch Sekundärrohstoffe wie Monomere, Pyrolyseöl (z. B. Naphtha) oder Synthesegas entstehen. Mit diesen Rohstoffen kann man anschließend Grundstoffe erzeugen, mit denen sich Kunststoffe in Neuwarequalität herstellen lassen. Sie denen zudem als Grundlage für weitere chemische Produkte und Kraftstoffe, sogenannter „Recycled Carbon Fuels“ (RCFs). Das Potenzial ist beträchtlich. Materialien, die bislang als nicht recycelbar galten, können so in die zirkuläre Wirtschaft integriert und als Ressource genutzt werden. Das geht einher mit niedrigeren CO₂-Emissionen.
Chemisches Recycling ist daher kein Ersatz, sondern eine wichtige Erweiterung der bestehenden Kreislaufwirtschaft – und ein Baustein der Molekülwende.
Die EU stellt höhere Anforderungen an Kunststoff-Recycling
Kunststoffe werden in der EU zu rund 80 Prozent aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Primärrohstoffe sollen zunehmend durch recycelte Materialien ersetzt werden.
Hier setzt die im Dezember 2024 verabschiedete EU-Verpackungsverordnung 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) an.
Sie sieht unter anderem Recyclingziele für Verpackungsabfälle, Quoten für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen sowie den Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen vor. Ab August 2026 tritt die Verordnung in Kraft. Das bereits bestehende Ziel für die Mitgliedstaaten, bis Ende 2025 65 % aller Verpackungsabfälle zu recyceln, bleibt bestehen. Es wird um spezifische Mindestquoten für einige der enthaltenen Materialien erweitert. Das Recyclingziel ab 2030 steigt gemäß der neuen Verordnung auf 70 % für sämtliche Verpackungsabfälle. Die Recyclingquote für Plastikverpackungen lag 2023 EU-weit noch bei gut 42 Prozent. Mit der PPWR soll der Anteil bis 2030 auf 55 Prozent steigen.
Für den Rezyklatanteil bei Kunststoffverpackungen sieht die PPWR zudem ab 2030 je nach Verpackungskategorie eine Mindestquote von 10 bis 35 Prozent vor. Bis 2040 sollen die Quoten sogar auf 25 bis 65 Prozent steigen. Um den Rezyklatanteil entsprechend erhöhen zu können, müssen die Recyclingkapazitäten hochgefahren werden. Nur so lässt sich die Kreislaufführung von Kunststoffen steigern. Das alles wird ohne chemisches Recycling kaum erreichbar sein.
EU arbeitet noch an einem rechtlichen Rahmen für chemisches Recycling
Der im Juli 2025 von der EU-Kommission vorgestellte „Chemical Industry Action Plan“ beinhaltet Impulse zugunsten des chemischen Recyclings. Das Maßnahmenpaket soll unter anderem auch Technologien für die Kreislaufwirtschaft fördern.
Besonders das chemische Recycling wird dabei als strategisch relevantes Innovationsfeld hervorgehoben – mit Aussicht auf gezielte Förderung, regulatorische Klarheit und verbindliche Rezyklatquoten. Diese sind dringend nötig.
Im November 2025 soll die Konsultation zum geplanten „Circular Economy Act“ enden. Diese zentrale EU-Verordnung über die Kreislaufwirtschaft ist Bestandteil des Clean Industrial Deal. Sie soll 2026 in Kraft treten. Der Rechtsakt soll unter anderem einen einheitlichen Binnenmarkt für Sekundärrohstoffe ermöglichen sowie das Angebot an hochwertigen recycelten Materialien erhöhen und die Nachfrage danach anregen. Chemisches Recycling soll etabliert werden, um nationale und europäische Recyclingziele zu erreichen. Dazu plant die EU, Investitionsanreize, Innovationspartnerschaften und die Einbettung in Förderprogramme wie „Horizon Europe“ systematisch zu unterstützen, um die Entwicklung und großtechnische Umsetzung des chemischen Recyclings voranzutreiben.
Debatte über Anerkennung von Verfahren und Produkten
Ob chemische Recyclingverfahren als geeignete Technologien zur Erzeugung von Rezyklaten anerkannt werden sollen, ist ein zentraler Punkt der laufenden Debatte. Ebenfalls wichtig sind die Massenbilanzierung und flexible Allokation von Rezyklat-Outputs.
Massenbilanzierung ist ein buchhalterisches Verfahren. Beim chemischen Recycling wird es eingesetzt, um den Anteil an recyceltem Material in Produkten transparent und nachvollziehbar zuzuordnen. Hauptgrund dafür ist: In großen chemischen Anlagen (z. B. Steamcracker) recycelte, biologische Rohstoffe oder andere nachhaltige Rohstoffe werden gemeinsam mit fossilen Rohstoffen verarbeitet. Im Endprodukt lassen sie sich physisch nicht mehr unterscheiden. Dieses Verfahren nennt man Co-Processing. Ein Beispiel: In einem Produktionszeitraum wird ein Zehntel recyceltes Pyrolyseöl eingesetzt. Dann kann rechnerisch ein Zehntel der Endprodukte als „aus recyceltem Material hergestellt“ deklariert werden, unabhängig vom exakten Rezyklatanteil des einzelnen Produkts.
Herausforderungen: Warum es in Deutschland (noch) nicht skaliert
Obwohl die Technologie so ein hohes Potenzial birgt, steckt das chemische Recycling von Kunststoffen in Deutschland noch in den Kinderschuhen. In Deutschland gibt es abgesehen von ersten Pilotanlagen aktuell keine einzige industrielle Pyrolyseanlage für Kunststoffabfälle, die im Dauerbetrieb läuft. Die Niederlande, Österreich oder die skandinavischen Staaten betreiben dagegen bereits erste industrielle Reaktoren.
Zu hohes Investitionsrisiko mangels rechtlicher Anerkennung
Das liegt in Deutschland an der unzureichenden Infrastruktur für die Sortierung und Vorbehandlung von Kunststoffabfall. Vor allem aber hemmt die rechtliche Unsicherheit bezüglich der Anrechenbarkeit den Hochlauf des chemischen Kunststoff-Recyclings. Bis dato ist nicht eindeutig geregelt, ob chemisch recycelte Materialien, wie Produkte aus Pyrolyseöl, regulatorisch als „Rezyklate“ gelten und somit zur Erfüllung der vorgegebenen Rezyklat-Quoten beitragen.
Im Falle der THG-Quote für Kraftstoffe im Verkehr schließt Deutschland sogenannte Recycled Carbon Fuels (RCF) als Erfüllungsoption bislang aus, obwohl RCF europarechtlich zugelassen sind. Dabei gibt die EU den Ländern bereits in der alten Renewable Energy Directive (RED II) die Möglichkeit, auch Recycled Carbon Fuels (RCFs) als Erfüllungsoption für den geforderten Mindestanteil von erneuerbarer Energie bzw. Treibhausgaseinsparungen im Verkehrssektor zu berücksichtigen. Die Bundesregierung hat mit der aktuell laufenden Überarbeitung der THG-Quotenregulierung die Chance, RCF sowie Gemische aus erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biogenen Ursprungs und RCFs in der nationalen Umsetzung der neuen RED III als Erfüllungsoption aufzunehmen.
Aufgrund der unzureichenden bzw. fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen mangelt es den Unternehmen an Investitionssicherheit. Der Aufbau industrieller Anlagen für chemisches Recycling ist derzeit mit einem hohen finanziellen Risiko behaftet. Unternehmen können nicht langfristig planen, da nicht sicher ist, ob ihre Recyclingprodukte vermarktet werden dürfen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Errichtung der nötigen Anlagen, etwa für die Pyrolyse oder die Solvolyse, mit hohen Genehmigungsaufwänden verbunden ist.
Fazit:
Das chemische Recycling schließt die Lücke zwischen dem etablierten mechanischen Recycling und der energetischen Verwertung. Es bietet eine Lösung für gemischte und verunreinigte Kunststoffabfälle, die zu wertvoll für die bloße Entsorgung sind. Das Beispiel ReOil der OMV zeigt, wie die Technologie für chemisches Recycling in einem Raffineriestandort sinnvoll eingebunden werden kann. Das ist nicht nur ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft und einer ressourceneffizienteren Rohstoffnutzung, sondern auch ein Beispiel für Transformation an einem großen Raffineriestandort. Grundvoraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg eines derartigen Projekts sind neben spezifischen Standortfaktoren geeignete rechtliche Rahmenbedingungen. Damit Deutschland beim chemischen Recycling nicht den Anschluss verliert, muss es auch seine Raffinerien als strategische Hubs einer zirkulären Molekülwirtschaft verstehen und entsprechend in der Regulierung berücksichtigen.
Chemisches Recycling: Das Beispiel OMV-Raffinerie Schwechat – Auf dem Weg zur industriellen Nutzung
AKTUELLE BEITRÄGE
Podcast: Grüner Wasserstoff ...